
Fans erkennen in den besten Computerspielen Meisterstücke der Ingenieurskunst, hochkomplexe Systeme, die nach einem exakten Plan bis ins kleinste Detail von einem Expertenteamausgetüftelt wurden. Oder sie verstehen sie als Kunstwerke, die mühevoll komponiert wurden, um die Gefühle und Ideen von Menschen in einer hochaktuellen Form zum Ausdruck zu bringen.
Diese Vorstellungen sind nicht falsch, aber sie tragen einem zu wenig Rechnung: Dass aller Planmäßigkeit zum Trotz in den letzten Jahren das kalkulierte Chaos und der kontrollierte Zufall zu einem der wichtigsten Motoren der Spieleentwicklung geworden sind. »Prozedurale Generierung« heißt das Verfahren, das von der Idee abrückt, alle Spielinhalte müssten bis ins Detail vonMenschenhand gestaltet werden.
Der Zufall kommt zurück
Stattdessen programmieren die Entwickler Algorithmen, mit deren Hilfe der Computer selbst solche Inhalte erstellen oder wenigstens kombinieren kann – wobei das Zufallsprinzip eine entscheidende Rolle spielt.
»Man kann sich das vorstellen wie eine Art Mini-Spieldesign innerhalb des Spieldesigns«, erläutert Chris Park, der Kopf des Indie-Studios Arcen Games, das mit Spielen wie A Valley Without Wind stark auf den Zufallsfaktor setzt. »Der Computer wäre dann der Spieler. Er nutzt die Möglichkeiten, die du ihm gibst, innerhalb der Grenzen, die du definierst.«
Diesem »Spiel im Spiel« können vielfältige und faszinierende Dinge entspringen: Die Welten von Minecraft, die vielbeinigen Viecher in Spore, die theoretisch 17 Millionen Waffen von Borderlands– sie alle sind das Resultat mehr oder weniger glücklicher Zufälle.
![]() Warren Robinetts Adventure (1979) war das erste Spiel, das erfolgreich versuchte, die Prinzipien des auf Heimcomputern beliebten Textadventures auf die Konsole zu holen. Die Beschränkungen des Atari 2600 verlangten allerdings ein Umdenken: Statt blumigen Beschreibungen lieferte Adventure krümelige Figuren, statt hirnmarternden Rätseln setzte es auf Action. Was blieb, war die Freude an der Entdeckung von Schätzen und die Furcht vor den herumwandernden Gegnern, die dank prozeduraler Generierung unberechenbar blieben.
Warren Robinetts Adventure (1979) war das erste Spiel, das erfolgreich versuchte, die Prinzipien des auf Heimcomputern beliebten Textadventures auf die Konsole zu holen. Die Beschränkungen des Atari 2600 verlangten allerdings ein Umdenken: Statt blumigen Beschreibungen lieferte Adventure krümelige Figuren, statt hirnmarternden Rätseln setzte es auf Action. Was blieb, war die Freude an der Entdeckung von Schätzen und die Furcht vor den herumwandernden Gegnern, die dank prozeduraler Generierung unberechenbar blieben.
Schuld am Zufall war die Hardware
Doch die prozedurale Generierung kam bereits lange vor diesen Spielen zum Einsatz. »Sie ist so alt wie das Medium selbst«, meint Chris Park.
»Ursache für die erste Blüte der Zufallsgenerierung waren Hardware-Beschränkungen. In den 80er-Jahren waren Konsolen stark limitiert, besonders in Sachen Speicher. Man hatte schlicht nicht genug Platz, um eine sinnvolle Zahl von Leveln unterzubringen, weshalb man auf prozedurale Generierung setzte.«
Die klügsten Köpfe der Epoche verstanden es, um diese Einschränkungen herum zu arbeiten und schufen dabei eine Reihe von Klassikern: Adventure (1979) von Warren Robinett etwa, welches das gleichnamige Genre zur Konsole brachte und den Spieler mit zufällig platzierten Gegenständen und Feinden das Erkunden und Fürchten lehrte.

Oder das Weltraumhandelsspiel Elite (1984), in dem David Braben und Ian Bell mit einfachsten Mitteln riesige, frei navigierbare Sternensysteme schufen. In keinem anderen Spiel konnte man den Zufall allerdings besser beim Werk betrachten als im »Ur-Diablo« Rogue (1980). Dessen Entwickler verzichteten bewusst auf allen zusätzlichen Ballast – die Grafik etwa besteht lediglich aus Buchstaben und Zeichen – und setzten ganz auf Komplexität und prozedurale Generierung als Attraktion.
Auch in Rogue erkundete man ein Verlies, doch im Gegensatz zu Adventure und Konsorten wurde dieses bei jedem neuen Spieldurchlauf nicht nur im Detail, sondern von Grund auf neu errichtet. Und Rogue war erbarmungslos mit allen, die es wagten, diese Zufallsarchitekturen zu betreten: Der Tod der Spielfigur ist unwiderruflich, Neuladen verboten. Wenig erstaunlich also, dass das Spiel eher ein Nischenphänomen blieb – bis die Geschichte ihm doch noch zum verdienten Ruhm verhalf.
![]() Rogue, um 1980 von Glenn Wichman, Ken Arnold und Michael Toy entwickelt, ist das ultimative Nerd- Game: auf Universitätsrechnern entstanden, von Dungeons&Dragons inspiriert, abstrakt, komplex, und alles andere als einsteigerfreundlich. Dabei ist die Ausgangslage simpel: Im Rundentakt muss ein Verlies erkundet werden, in dem immer stärkere Gegner warten. Was Rogue von der Konkurrenz abhob und das Genre der »Roguelikes« prägte, war die herausfordernde Kombination aus den prozedural generierten Levels und dem unwiderruflichen Tod der Spielfigur.
Rogue, um 1980 von Glenn Wichman, Ken Arnold und Michael Toy entwickelt, ist das ultimative Nerd- Game: auf Universitätsrechnern entstanden, von Dungeons&Dragons inspiriert, abstrakt, komplex, und alles andere als einsteigerfreundlich. Dabei ist die Ausgangslage simpel: Im Rundentakt muss ein Verlies erkundet werden, in dem immer stärkere Gegner warten. Was Rogue von der Konkurrenz abhob und das Genre der »Roguelikes« prägte, war die herausfordernde Kombination aus den prozedural generierten Levels und dem unwiderruflichen Tod der Spielfigur.
Rogue erwies sich nämlich als äußerst einflussreich. Nicht nur Blizzards Diablo-Spiele verdanken dem Spiel einiges – Rogue wurde auch zum wichtigen Impuls für eine zweite Blüte der prozeduralen Generierung, die seit einiger Zeit unübersehbar ist. Die Kreuzung der zentralen Ideen des Urahns mit neuen Genres hat einige der aufregendsten Spiele der letzten Jahre hervorgebracht: Dwarf Fortress bleibt der Minimalgrafik, dem Mut zum Untergang und dem Zufall als entscheidendem Faktor treu, erfindet das Konzept aber neu als chaotische Simulation einer Zwergenbehausung.
Spelunky hat unter dem Tropenhut eines zum Scheitern verurteilten Archäologen erfolgreich den Platformer mit der Zufallsgenerierung und dem unwiderruflichen Tod vermählt, während The Binding of Isaac der Formel (neben viel Blut, Wahnsinn und Tränen) einen Schuss Zelda hinzufügt.
Doch auch abseits dieser direkten Rogue-Erben wird Letzterem zunehmend Gewicht eingeräumt: Mobile-Spiele wie Canabalt, Jetpack Joyride oder Temple Run lassen ihre Helden durch endlose Level preschen und feiern damit gewaltige Erfolge. Und auf dem PC zeigen Spiele wie Minecraft, Terraria oder das besinnliche Proteus, dass auch ohne Dauertod entzückende Welten aus den Spielräumen zwischen Algorithmen erschaffen werden können.



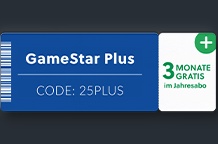
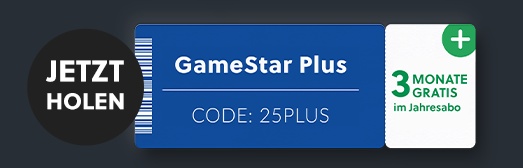




Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.