
Der Weltuntergang lässt sich Zeit. Soviel ist sicher. Seit den 1950er Jahren hängt er über der Medienkultur wie ein Damokles-Schwert, das mal hier im Film, mal dort in der Literatur und - spätestens seit Interplays Wasteland von 1988 - auch in der Spieleindustrie niedergeht, im November 2018 etwa in Fallout 76 von Bethesda.
Jede menschliche Kultur hat eigene Untergangsmythen. Angefangen bei antiken Schöpfungsmythen wie dem Gilgamesch-Epos über den Maya-Kalender, der das Ende aller Zeiten auf den 21. Dezember 2012 datierte (Ha, überlebt!) bis hin zum Ragnarök der nordischen Mythologie und zum biblischen Buch der Offenbarung, das im Niedergang des Satans und im Weltgericht endet - die Apokalypse gehört zum Menschen wie die Soße auf die Currywurst.
Kein Wunder also, dass Spiele auf den Weltuntergangszug aufspringen. Was aber fasziniert uns am Ende aller Dinge - und vor allem an der Zeit danach? Und warum wecken Spiele-Entwickler zwar gerne unsere Lust am Untergang, gehen dabei aber nicht weit genug?

Die Autorin
Mit Apokalypsen, Utopien und Dystopien hat die Nürnberger Journalistin und Autorin Nora Beyer alle Hände voll zu tun. So auch in ihrem gerade im Berliner Periplaneta-Verlag erschienen Roman »Die Gleichheit der Blinden«, der sich um soziale Ungerechtigkeiten, eine zerrissene Gesellschaft und den potenziellen Weltuntergang dreht. Und um die Fantasie als treibende Kraft aller Dinge. Nun hat sie sich auf die Suche gemacht nach postapokalyptischen Spielen und spürt der Faszination nach, die wir für die Zeit nach dem Ende der Zeitrechnung empfinden.

Der Anfang vom Ende
Prägend für die Zeiten, zu denen der Weltuntergang mit Vorliebe aufgegriffen wird, sind Naturkatastrophen, Wirtschaftskrisen, Hungersnöte, Kriege. Wenn alles den Bach runterzugehen scheint, dann geht gerne die Welt im Ganzen denselben hinunter. Mit apokalyptischen Mythen reagieren Menschen oft auf historische Ereignisse, zumeist als radikal empfundene Umbrüche.
Das hat einen Vorteil: Dem Unerklärlichen oder Ungewollten wird so ein Sinn zugeteilt. Das Chaos bekommt eine Ordnung und wird gewissermaßen gezähmt. Ein Vulkanausbruch ist eben kein (für Normalsterbliche) unberechenbarer Zufall, sondern ein göttliches Zeichen des Niedergangs. Oder eine Warnung vor Selbigem. Zugleich ist die Apokalypse ein Lehrstück: Sie soll etwa - wie im babylonischen Gilgamesch-Epos - aufzeigen, dass der Mensch sich von seinem Hochmut lösen und seine Sterblichkeit akzeptieren muss.
Das biblische Weltgericht verbindet diesen Showdown mit dem endgültigen moralischen Auswahlverfahren: Jede menschliche Existenz wird bewertet und einsortiert - in Himmel oder Hölle. Die Apokalypse soll uns also mit erhobenem Zeigefinger daran erinnern, dass wir (A) endlich sind und uns (B) aus ebendiesem Grund zu Lebzeiten möglichst »gut« benehmen sollen.
Die Welt geht unter? Gott hilft (vielleicht): Religion in Spielen in der Plus-Analyse




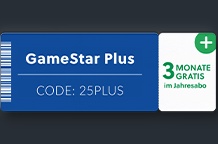
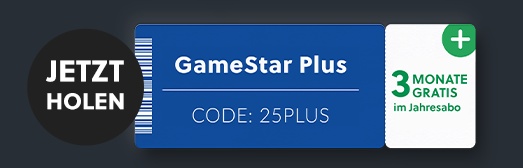






Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.